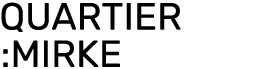Eine sorgende Nachbarschaft | Ein Kommentar
Im vergangenen 52. Forum:Mirke im Autonomen Zentrum an der Gathe sprachen die Beteiligten unter anderem über den Umgang mit Diskriminierung im Quartier. Anlass dafür waren zwei rassistische Vorfälle, die sich in den letzten Monaten auf der Nordbahntrasse ereigneten. Dabei stellte sich auch die Frage, wie wir als Quartier mit derartigen Situationen umgehen sollten und welche Interventionen überhaupt möglich sind.

Diskriminierung ist leider keine Seltenheit. Angehörige marginalisierter Gruppen erfahren sie in allen gesellschaftlichen Gefilden – bei der Arbeit, im ÖPNV, beim Einkaufen oder eben beim alltäglichen Spazieren durchs Quartier. Dass dies für einige nicht vorstellbar ist, ist vor allem Ausdruck der Privilegien, die Menschen unsichtbar mit sich herumtragen. Während einige den Spaziergang über die Trasse sorglos genießen können, müssen andere sich ständig auf weitere, grundlose Anfeindungen gefasst machen. „Sorglos“ ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Problems, denn so lange Menschen die Augen vor diskriminierenden Vorfällen verschließen, sind Angehörige marginalisierter Gruppen einer signifikant größeren Gefahr ausgesetzt. Aber Sorglosigkeit ist nicht als ein individuelles Phänomen zu betrachten. Vielmehr wird es von dem System, in dem wir leben, hervorgebracht und schlussendlich sogar belohnt.
Sorge ist eng verknüpft mit der Abhängigkeit, der wir als Menschen unterliegen. Denn schlussendlich sind wir alle grundlegend von anderen Menschen abhängig. Diese Abhängigkeit zeigt sich teils ganz konkret, wie z.B. in der Kindererziehung oder der Pflege von kranken und alten Menschen. Zu großen Teilen aber wird sie durch gesellschaftliche Prozesse verschleiert. Statt diese Abhängigkeit anzuerkennen, einander zu versichern, dass wir uns umsorgen und umsorgt werden, und diese Idee folgenreich zu gestalten, sucht uns der ständige Drang der Individualisierung heim, indem „jede*r ist seines*ihres Glückes Schmied*in“ Realität wird. Sich der Diskriminierung hinzugeben, die andere Menschen erfahren, macht im Hinblick auf die herrschende Logik scheinbar keinen Sinn. Aber was passiert, wenn wir uns der notwendigen Sorge bewusst werden und verstehen, dass das Leid eines*einer Einzelnen von uns allen abhängt? Und was passiert, wenn wir diese Erkenntnis nicht nur als Individuum, sondern als Quartier, als Nachbar*innen, Realität werden lassen?

Eine sich sorgende Nachbarschaft könnte diskriminierende Vorfälle nicht aus der Welt schaffen. Aber sie könnte Sorge dafür tragen, dass die Betroffenen gehört und aufgefangen werden, indem Modi der solidarischen Unterstützung in der Zusammenarbeit mit Betroffenen gefunden werden. Die Stimmen der Opfer von Diskriminierung könnten so durch die Nachbarschaft verstärkt und gehört werden, während wir uns gemeinsam nach den Bedürfnissen der Personen richten, die innerhalb unseres Quartiers marginalisiert werden. Dabei sind öffentliche Einrichtungen und professionelle Träger, wie die „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus“ (Link) oder die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wuppertal (Link) wichtig. Es jedoch dabei zu belassen, verfehlt das Problem, der Diskriminierung selbst und nicht bloß ihren Folgen den Kampf anzusagen. Zeitgleich bedarf es daher auch der Reflexion unserer verkörperten Privilegien, die wir alle mit uns herumtragen. Nur wenn wir Diskriminierung als solche wahrnehmen können, wenn wir uns mit ihr auseinandergesetzt haben und sie in den alltäglichen Strukturen entdecken, können wir ihr auch entschieden entgegentreten. Dafür braucht es kollektiven Austausch, Solidarität und vor allem organisierte Zivilcourage. Apropos: Kollektiver Austausch. Eine sorgende Nachbarschaft braucht nicht nur Strukturen, sondern auch Orte, in denen Sorge sich materialisieren kann. Schließlich bringt es Betroffenen nichts, Solidarität als Lippenbekenntnis zu erfahren, wenn die materiellen Konsequenzen luftleer bleiben. Orte wie das Autonome Zentrum an der Gathe, die Antidiskriminierung als Grundfeste ihrer Existenz verstehen und safer spaces (sicherere Räume) darstellen, sind daher essenziell.
Schlussendlich muss auch das Quartier daran scheitern, einen sicheren und diskriminierungsfreien Raum unter den gegebenen Umständen herzustellen. Diese Utopie ist im Rahmen gesellschaftlicher Mechanismen, die maßgeblich auf der Abwertung marginalisierter Gruppen basieren, schlichtweg nicht realisierbar. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass wir gemeinsam daran arbeiten können, Räume sicherer zu gestalten und gegen jegliches Unrecht aufzustehen. Gemeinsam, als Nachbarschaft und Quartier. Im 52. Forum:Mirke haben die Beteiligten sich darauf geeinigt, eben jenes Vorhabens im nächsten Jahr anzugehen und einen Stadtentwicklungssalon zum Thema Antidiskriminierung im Quartier auszurichten. Inwiefern aus dieser Veranstaltung weitläufigere Prozesse angestoßen werden, bleibt abzuwarten.